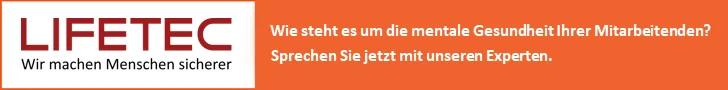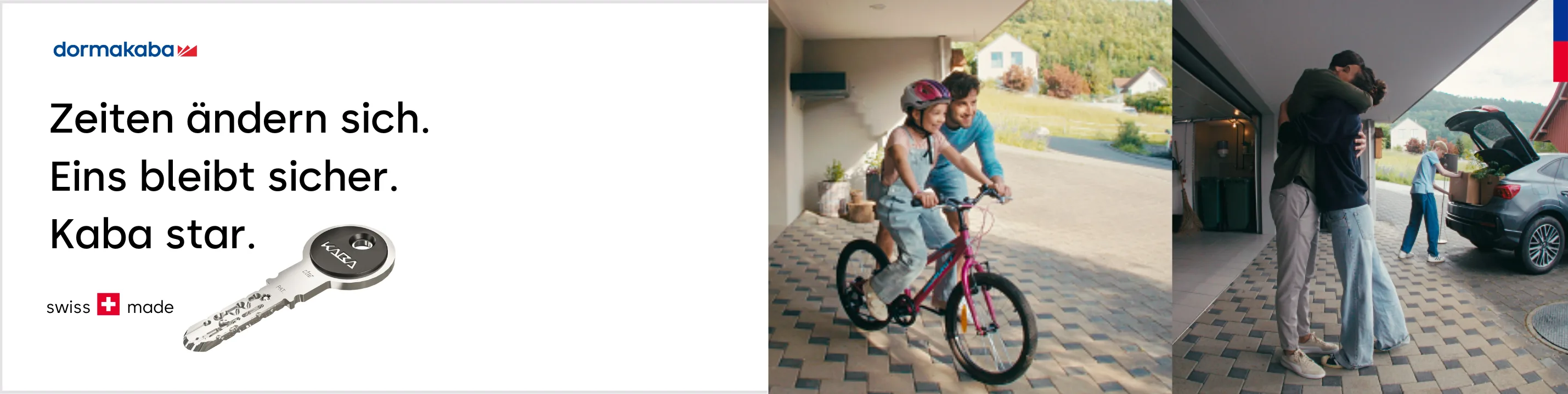Eine Studie des SLF zeigt: Die Wassertemperaturen in europäischen Berggewässern steigen seit Jahrzehnten. Der Klimawandel gefährdet damit Wasserqualität, Fische, Industrie- und Stromproduktion – und hält der Trend an, werden ökologische Kippunkte erreicht. Aktuelle Prognosemodelle zur Hitze in Flüssen ignorieren bislang wichtige Ursachen des Temperaturanstiegs.
Das Wasser in den Gebirgsflüssen und -bächen wird immer wärmer, mit negativen Folgen für Trinkwasser, Industrie, Forellen und viele mehr. Wie warm und woran das liegt, hat SLF-Hydrologin Amber van Hamel für fast 180 Gewässer in verschiedenen Bergregionen Europas untersucht, sowohl für den langfristigen, durchschnittlichen Trend als auch für einzelne Extremsituationen.
Klar ist: Die in Zeiten des Klimawandels immer wärmer werdende Luft erwärmt auch Fliessgewässer. Aber das ist nicht der einzige, wichtige Effekt. Bei extremen Wassertemperaturen spielen Bodenfeuchtigkeit, Grund- und Schmelzwasser ebenfalls eine Rolle. Aktuelle Computermodelle prognostizieren solche Ereignisse allerdings nur auf Basis der Lufttemperatur, erklärt van Hamel: «Sie eignen sich daher eigentlich nicht für die Vorhersage extremer Wassertemperaturen.»
Hitze in Flüssen hat vielfältige Auswirkungen
Dabei wären zuverlässige Vorhersagen wichtig. «Solche extremen Wassertemperaturen können ökologische Kipppunkte auslösen», betont die Forscherin. So steigt die Sterblichkeit der Forellen bei Temperaturen von mehr als 23 Grad Celsius. Aber nicht nur die bei Anglern beliebten Fische, die gesamte Biodiversität der Ökosysteme in den Gewässern ist bedroht. Auch können die hohen Temperaturen die Qualität des Wassers reduzieren, was für die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser in manchen Regionen zum Problem werden kann. Zudem können Industrie- und Versorgungsunternehmen ihre Produktionsbetriebe und Kraftwerke nicht mehr ausreichend kühlen, so dass sie gezwungen sind, den Betrieb zu drosseln oder gar einzustellen.

Für ihre Untersuchung hat sie Zeitreihen aus 177 Gewässern und deren Einzugsgebieten in den Alpen, den Pyrenäen, dem französischen Zentralmassiv und den Bergen Skandinaviens untersucht, darunter 35 aus der Schweiz wie Emme, Rhone und den Dischmabach bei Davos. «Die mittlere Wassertemperatur hat in den vergangenen dreissig Jahren pro Jahrzehnt um 0,38 Grad Celsius zugenommen, was zu mehr extremen Wassertemperaturen in hohen Lagen im Frühjahr und Sommer führt», hat van Hamel dabei herausgefunden. Das sind immerhin rund 1,1 Grad mehr im Vergleich zu 1994.
Die höchsten Temperaturen werden in den Pyrenäen, im Zentralmassiv und in den Alpen im Sommer gemessen. Einige Einzugsgebiete erreichen bereits regelmässig 23 Grad Celsius und mehr. «Die höchste beobachtete Wassertemperatur in einem einzelnen Einzugsgebiet war 28 Grad Celsius im Schwarzbach in Österreich», sagt van Hamel. Die Gewässer im Zentralmassiv sind alle vergleichsweise warm. In den Pyrenäen und den Alpen hingegen sind die Unterschiede gross. Grund sind die grösseren Höhenunterschiede in den Einzugsgebieten
In den Alpen hat van Hamel für alle vier Jahreszeiten einen Trend nach oben beobachtet, mit einem besonders starken Plus im Sommer. «Wenn wegen des Klimawandels im Winter weniger Schnee fällt, gelangt im Frühling und Sommer weniger kühles Schmelzwasser in die Flüsse», erläutert sie das Phänomen. Hinzu kämen verstärkt Dürren. Dadurch nimmt die Feuchte des Bodens ab. Weniger kaltes Grundwasser gelangt in die Flusssysteme.
Anders sieht es bei den Extremen aus. Hier haben die Wassertemperaturen in der Spitze kaum zugelegt. «Aber die Zahl dieser Ereignisse ist deutlich gestiegen», hat van Hamel beobachtet – um sieben Tage pro Jahrzehnt, über alle Jahreszeiten hinweg. Das ist ein Plus von 3.8 Prozent pro Jahrzehnt.
«Die beobachteten Trends deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit der Beobachtung von extremen Wassertemperaturen in Zukunft höchstwahrscheinlich zunehmen wird», ist sich van Hamel sicher. Der Bedarf an korrekten Prognosen steigt. Sie empfiehlt daher, die bestehenden Modelle zu verbessern und ausser der Lufttemperatur auch andere Faktoren zu berücksichtigen.