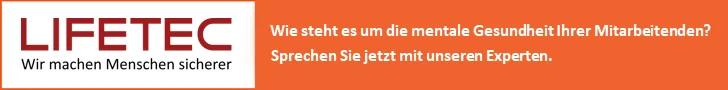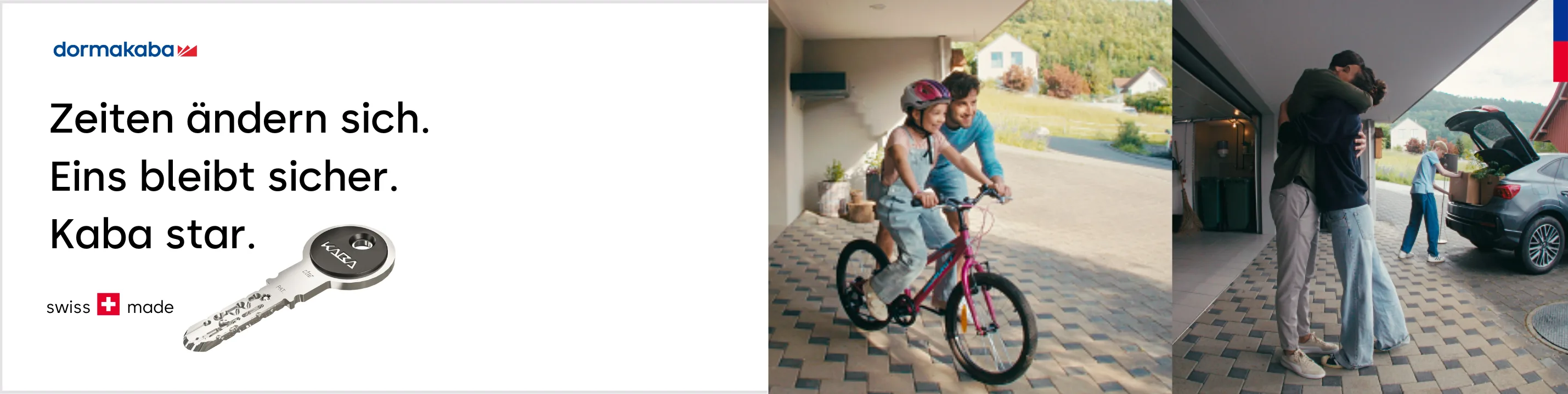Big Tech-Unternehmen und soziale Medien wie Instagram sind bekanntlich die grössten Eindringlinge in die Privatsphäre, und die grosse Menge an persönlichen Daten, die über Apps abgegriffen werden, nimmt stetig zu. Kaum jemand liest das Kleingedruckte in den Nutzungsbedingungen oder Datenschutzrichtlinien. Wir setzen einfach ein Häkchen, wenn wir eine App herunterladen, und erlauben dem App-Anbieter somit, ganz legal unsere Daten zu stehlen.
Hier geht es um sehr persönliche Informationen: Was man einkauft, wieviel man dafür ausgibt, den aktuellen Standort, den gesamten Such- und Browserverlauf, Kontaktdaten oder auch Informationen zum eigenen Gesundheitszustand. Diese sensiblen Daten werden nicht nur gesammelt und gespeichert, sondern auch an den Meistbietenden verkauft. Und wer weiss schon, wo diese Informationen schlussendlich überall landen? Keine schöne Vorstellung.
Instagram ist Datendieb Nummer 1
Eine aktuelle Studie von Statista zeigt, dass das Problem noch grösser ist als befürchtet: Hier wurden 50 der beliebtesten Apps darauf untersucht, welche Menge an persönlichen Daten sie speichern und weitergeben. In der Rangliste treffen wir auf die üblichen Verdächtigen: Der traurige Spitzenreiter ist Instagram. Die Plattform verkauft erschreckende 79 Prozent der gespeicherten Daten an Dritte. Facebook teilt 57 Prozent aller persönlichen Daten mit Dritten, während LinkedIn die Hälfte aller gespeicherten sensiblen Daten – nicht nur Kontaktdaten, sondern auch den Standort oder die Suchhistorie seiner Nutzer – an Drittanbieter verkauft. Dicht dahinter folgen YouTube (43 Prozent) und TikTok (36 Prozent). Und auch die Dating App Tinder teilt 21 Prozent der persönlichen Informationen über seine Nutzer mit Dritten.
Viele Schweizer zögern, die sichere und transparente Corona-Warn-App zu nutzen, aus Angst vor Verletzungen ihrer Privatsphäre. Gleichzeitig nutzen wir wissentlich weiterhin Apps wie Instagram, Facebook, YouTube und TikTok, die unsere Daten massiv ausnutzen und in unsere Privatsphäre eindringen. Warum machen wir das? Die Antwort liegt im sogenannten Netzwerkeffekt.
Der Netzwerk- und der FOMO-Effekt
Der Netzwerkeffekt bindet uns an unsere Online-Communities. Denn wenn beispielsweise jeder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis eine bestimmte Social-Media-App verwendet, muss man diese auch selbst nutzen, wenn man mit diesen Menschen kommunizieren möchte. Dazu kommt der „FOMO-Effekt“, die sogenannte „Fear of missing out“: die Sorge etwas zu verpassen, wenn man nicht Teil der Online-Community ist. Der Netzwerkeffekt bringt uns dazu, diese Plattformen trotz aller Bedenken zu nutzen und den hohen Preis unserer Privatsphäre zu zahlen. Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube kommen ungeschoren davon.
Der Datenschutz wird in der heutigen Zeit zu einem immer brisanteren Thema in der Tech-Branche und es kommen immer mehr datenschutzfreundliche Alternativen für gängige Online-Tools und -Produkte auf den Markt. Obwohl diese oft die gleichen Funktionen und Dienste anbieten, sind viele der Nutzer durch den Netzwerkeffekt an die etablierten Anbieter gefesselt. Ein Wechsel fällt schwer.
Wie kann man dieses Problem angehen? «Ein guter erster Schritt ist es, zuerst die einfacheren Dinge zu ändern», sagt Startpage-CEO Robert E.G. Beens. «Datenschutzkonforme Suchmaschinen, anonyme Ansichten oder Tools wie die Jumbo-App für mehr Privatsphäre bei Social-Media-Plattformen können helfen. Ich glaube, wir dürfen es Big Tech nicht so einfach machen. Natürlich wollen wir uns auch weiterhin miteinander austauschen und am Leben anderer teilhaben. Aber wir haben die Möglichkeit, uns dabei besser zu schützen – ob nun mit zusätzlichen Tools vor den üblichen Verdächtigen oder durch die Verwendung datenschutzkonformer Alternativen. Es ist an der Zeit, die Sicherung unserer Privatsphäre in die eigene Hand zu nehmen.»
Lesen Sie auch: «Sicherheitsgefühl in Schweizer Städten: Kameras in der Öffentlichkeit, während und nach der Pandemie»